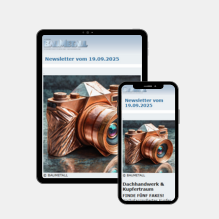Wenn ein gewisses Alter erreicht wird und/oder die wirtschaftliche Lage (nicht mehr) befriedigend ist, ist für einen Bauhandwerker der Zeitpunkt gekommen, seine unternehmerische Tätigkeit zu beenden. An Externe verkauft bzw. an Mitarbeiter oder Angehörige weitergegeben werden kann ein Einzelunternehmen nicht. Es fehlt die Trennung von Inhaber und Unternehmen, die bei einer Kapitalgesellschaft, meistens in Form der GmbH, gegeben ist. Ein Einzelunternehmer kann nur einzelne Aktiva veräußern, wenn er seine Tätigkeit beendet, oder diese ins Privatvermögen überführen. Hieraus können erhebliche Steuerbelastungen entstehen.
Schlussbilanz und Aufgabegewinn
Unabhängig von der betrieblichen Rechtsform muss mit einer Firmenschließung der Betriebsaufgabegewinn ermittelt und eine Schlussbilanz erstellt werden. Neben der Schlussbilanz muss der Bauhandwerker seinen Betriebsaufgabegewinn ermitteln. Ein Aufgabegewinn entsteht, weil Wirtschaftsgüter wie Maschinen oder Fahrzeuge meist durch die steuerlichen Abschreibungen mit einem geringeren Wert als dem Verkehrswert in der Bilanz stehen. Vor allem Grundstücke und Gebäude sind im Laufe der Geschäftstätigkeit oft wertvoller geworden, da der Grundstückswert seit dem Erwerb bzw. der Gründung bilanziell fortgeschrieben und die Gebäude zwischen 2 und 3 % jährlich abgeschrieben wurden. Wurde bspw. vor 25 Jahren bei der Übernahme des Betriebs das Gebäude mit 300 000 EUR bewertet und der Anteil der Geschäftsräume mit 33 % bzw. 100 000 EUR festgelegt und erfolgte eine Abschreibung von 2 % jährlich, sind die Geschäftsräume nunmehr mit 50 000 EUR bewertet. Ergibt sich aufgrund der allgemeinen Wertsteigerung ein Wert von 600 000 EUR, sind die Geschäftsräume 198 000 EUR wert, mithin liegt ein Buchgewinn von 148 000 EUR vor.
Zur Ermittlung des Betriebsaufgabegewinns werden die Erlöse aus der Betriebsaufgabe sowie der Wert der ins Privatvermögen überführten Güter mit dem Buchwert des Betriebsvermögens verrechnet. Wer zum Beispiel einen Firmenwagen privat übernimmt, schätzt den aktuellen Verkehrswert des Fahrzeugs anhand von Vergleichswerten, bspw. aus Verkaufsportalen im Internet. Gebäude- und Grundstückswerte sind nachvollziehbar zu ermitteln, wozu Gutachten erforderlich werden, deren Kosten zu den Aufgabekosten zählen.
Ermäßigter Steuersatz bei Betriebsaufgabe
Der Aufgabegewinn muss versteuert werden, auch wenn die Betroffenen keine Einnahmen erzielen, weil eine private Nutzung vorgesehen ist. Dies ist bspw. der Fall, wenn Gebäude und Grundstück zukünftig nur noch privat genutzt werden, der Bauhandwerker im wortwörtlichen Sinne seine Ruhe haben möchte und keine Aktivitäten mehr auf seinem Grund zulässt. Handelt es sich um eine Betriebsaufgabe im Ganzen und werden alle wesentlichen Betriebsgrundlagen in kurzer Zeit veräußert oder ins Privatvermögen überführt, besteht ein Steuerfreibetrag von 45 000 EUR sowie ein ermäßigter Steuersatz auf höhere Beträge. Diesen Freibetrag kann jeder Steuerpflichtige einmalig nutzen, sofern zum Zeitpunkt der Betriebsaufgabe das 55. Lebensjahr vollendet ist oder dauerhafte Berufsunfähigkeit vorliegt. Ab einem Aufgabegewinn von 136 000 EUR bis zum Höchstbetrag von 181 000 EUR schmilzt der Freibetrag graduell auf null ab.
Im Rahmen der Betriebsaufgabe gibt es zwei Möglichkeiten, den ermäßigten Steuersatz in Anspruch zu nehmen. Einerseits besteht die Fünftel-Regelung, die bei außerordentlichen Einkünften die Steuerprogression abfedert. Alternativ können über 55-Jährige einmalig den ermäßigten Steuersatz für Einkünfte von maximal fünf Millionen EUR aus einer Betriebsaufgabe beanspruchen. Dieser ermäßigte Steuersatz beträgt 56 Prozent des durchschnittlichen Steuersatzes des Steuerzahlers, allerdings mindestens den Eingangssteuersatz von 14 %. Diese Steuerermäßigung ist nutzbar, wenn die Betriebsaufgabe in einem einheitlichen Vorgang erfolgt und maximal drei Jahre beansprucht. Umsatzsteuer wird sowohl bei der Überführung ins Privatvermögen als auch beim Verkauf einzelner Wirtschaftsgüter fällig.
Steuerstrategien
Da die aufgezeigten Vergünstigungen erst mit dem vollendeten 55. Lebensjahr genutzt werden können, sollten jüngere Betroffene erwägen, bis zu diesem Zeitpunkt ihren Betrieb fortzuführen. Für einen begrenzten Zeitraum ist es möglich, den Betrieb ruhen zu lassen, sofern eine Fortsetzung theoretisch realistisch erscheint. Hierüber ist das Finanzamt formlos zu informieren. Dies kann bspw. sinnvoll sein, wenn ein 53-Jähriger eine Festanstellung annimmt und die Versteuerung mit 55 Jahren anstrebt.
Kapitalerträge werden pauschal mit 25 % besteuert, alle übrigen Einkunftsarten steuerlich zusammengefasst. Aufgrund der Steuerprogression sollten deshalb weitere steuerpflichtige Einkünfte, die keine Kapitalerträge darstellen, auf andere Jahre verlagert werden, bzw. die Betriebsschließung u.U. verlagert werden. Ebenso sollte eine andere, steuerpflichtige Tätigkeit evtl. erst in einem späteren Jahr aufgenommen werden. Bei einer gemeinsamen Veranlagung mit dem Ehepartner ist dessen steuerliche Einkunftssituation zu berücksichtigen. Plant der Partner evtl. den Ruhestandseintritt und erzielt danach geringere Einkünfte, wäre dieser Zeitraum für die Betriebsschließung steuerlich vorteilhafter.